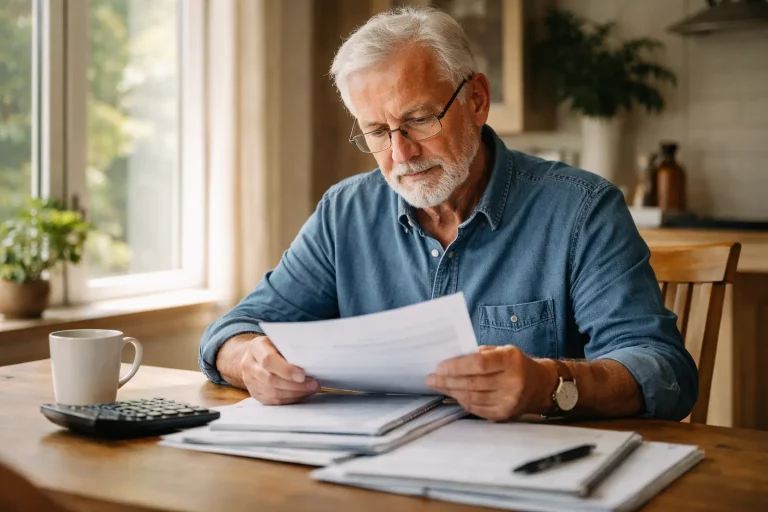Kurzzeitpflege 2026
(Gemeinsamer Jahrestopf für Kurzzeit- & Verhinderungspflege).
Keine Wartezeit (Sofort nutzbar).
Meist passiert es ganz plötzlich: Ein Sturz, ein Schlaganfall oder die pflegende Ehefrau fällt selbst krankheitsbedingt aus. Wenn die Pflege zu Hause vorübergehend nicht mehr möglich ist, greift die Kurzzeitpflege als Sicherheitsnetz.
Kurz erklärt: Die Kurzzeitpflege ist eine „Pflege auf Zeit“ in einer vollstationären Einrichtung (Pflegeheim). Ziel ist es dabei immer, die Zeit zu überbrücken, bis die Rückkehr in das eigene zu Hause wieder möglich ist.
Wann habe ich Anspruch auf Kurzzeitpflege?
Der Gesetzgeber sieht diese Leistung für Krisensituationen und Übergangsphasen vor, wenn ein Pflegebedürftiger vorübergehend zu Hause nicht versorgt werden kann. Das sind die drei häufigsten Fälle:
Der Klassiker: Die OP ist überstanden, aber für den Haushalt sind Sie noch zu schwach ("Übergangspflege").
Die pflegende Person wird selbst krank, muss zur Reha oder ist durch die Pflege völlig überlastet.
Sie suchen einen dauerhaften Heimplatz, haben aber noch keinen gefunden? Die Kurzzeitpflege überbrückt diese Lücke.
Rechtsgrundlage: § 42 SGB XI (Kurzzeitpflege)
Die Kurzzeitpflege ist damit ein wichtiges Angebot, das Pflegebedürftigen Sicherheit gibt und Angehörige entlastet.
Unterschied & Kombination: Kurzzeitpflege vs. Verhinderungspflege
Viele verwechseln die Kurzzeitpflege mit der Verhinderungspflege. Beide Leistungen dienen zwar der Entlastung von Angehörigen, unterscheiden sich jedoch deutlich:
- Kurzzeitpflege findet in einer stationären Einrichtung statt.
- Verhinderungspflege kann zu Hause oder ebenfalls in einer Einrichtung erfolgen, wenn die Hauptpflegeperson ausfällt.
Sie können beide Leistungen jedoch auch kombinieren. Das erhöht die Flexibilität von Angehörigen und den finanziellen Spielraum für Familien.
Das Gemeinsame Jahresbudget 2026
Schluss mit komplizierten Rechenspielen! Seit der Reform gibt es einen einzigen großen Geldtopf. Sie entscheiden flexibel, wie Sie das Geld aufteilen.
Ersatzpflege bei Ihnen zu Hause.
(z. B. durch Pflegedienst, Nachbarn oder Verwandte)
Stationäre Pflege auf Zeit im Pflegeheim.
(z. B. nach Krankenhausaufenthalt oder Krisen)
Nicht vergessen: Ihr monatliches Extra
Er wird nicht mit dem Jahresbudget verrechnet und steht Ihnen zusätzlich zur Verfügung.
Kombinationsmöglichkeiten mit Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege
Seit Juli 2025 ist die Nutzung der beiden Pflegearten für Betroffene und Angehörige endlich flexibler geworden: Für beide Leistungen steht Ihnen ein gemeinsames Jahresbudget von bis zu 3.539 € zur Verfügung.
Familien können nun frei entscheiden, wie sie diesen Betrag einsetzen. So können Sie zum Beispiel mehr Kurzzeitpflege nach einer Operation oder mehr Verhinderungspflege, wenn die Hauptpflegeperson mehrere Wochen verhindert ist, in Anspruch nehmen.
Ein konkretes Rechenbeispiel (2026):
* Hinweis: Dies ist eine Beispielrechnung. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Tagessatz des jeweiligen Pflegeheims ab. Der verbleibende Betrag kann flexibel für die Betreuung zu Hause genutzt werden.
Lassen Sie sich von den Zahlen nicht stressen: Sie müssen sich nicht schon im Januar festlegen, wie Sie das Budget über das ganze Jahr aufteilen. Der Gesetzgeber möchte mit dem gemeinsamen Jahresbudget vor allem eines schaffen: Mehr Flexibilität für Angehörige und Betroffene.
Oft ändert sich der Pflegebedarf im Laufe des Jahres ganz plötzlich. Gut zu wissen ist daher nur: Das Geld ist da und Sie können es genau dort einsetzen, wo es gerade am dringendsten gebraucht wird, möglicherweise für einen kurzen Aufenthalt im Pflegeheim oder für Unterstützung in den eigenen vier Wänden, wenn pflegende Angehörige eine verdiente Pause brauchen
Oder suchen Sie eine Vertretung für zu Hause?
Möchten Sie, dass die Pflegeperson in der gewohnten Umgebung (den eigenen vier Wänden) vertreten wird, statt den Pflegebedürftigen in ein Heim zu geben? Dann nutzen Sie die Möglichkeiten der Verhinderungspflege.
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege verfolgen ein gemeinsames Ziel: Entlastung für pflegende Angehörige und Sicherheit für Pflegebedürftige.
Der große Unterschied liegt jedoch im Ort der Betreuung: Kurzzeitpflege findet im Heim statt, Verhinderungspflege meist zu Hause.
Dank des neuen gemeinsamen Entlastungsbudgets lassen sich beide Leistungen flexibel kombinieren. Wer die Unterschiede kennt und die Planung frühzeitig angeht, kann die optimale Lösung für seine persönliche Situation finden.
Voraussetzungen für Kurzzeitpflege
Damit die Pflegekasse die Kosten für die Kurzzeitpflege übernimmt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wichtig ist vor allem, dass ein Pflegegrad vorliegt. Doch es gibt auch Sonderregelungen, wie etwa nach einem Krankenhausaufenthalt, die eine Kurzzeitpflege ermöglichen.
Pflegegrad als Voraussetzung
Ab Pflegegrad 2 (bis 5)
Sie haben vollen Anspruch auf das Gemeinsame Jahresbudget (3.539 €).
- Keine Wartezeit: Der Anspruch besteht ab dem ersten Tag der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad-Feststellung).
- Der Ort ist entscheidend: Die Pflege muss in einer zugelassenen stationären Einrichtung stattfinden (z.B. Kurzzeitpflegeplatz im Pflegeheim oder eingestreute Betten).
Pflegegrad 1
Hier zahlt die Pflegekasse das Budget für Kurzzeitpflege leider nicht.
Ihre Option: Sie können den Entlastungsbetrag (131 € / Monat) nutzen, um zumindest die Kosten für Unterkunft & Verpflegung im Heim teilweise zu finanzieren.
Kein Pflegegrad (Sonderfall)
Hier greift nicht die Pflegeversicherung, sondern die Krankenkasse.
- Das Gesetz: Fragen Sie nach "Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit" (gemäß § 39c SGB V).
- Voraussetzung: Plötzliche schwere Krankheit oder OP, bei der zu Hause keine Versorgung möglich ist.
Das bedeutet: Wer noch keinen Pflegegrad hat, sollte möglichst frühzeitig einen Pflegeantrag bei der Pflegekasse stellen.
Sonderfälle: Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt oder in Notsituationen
Neben der regulären Kurzzeitpflege nach SGB XI gibt es Sonderfälle:
- Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt (Übergangspflege über die Krankenkasse)
- Akute Notsituationen, etwa wenn die Pflegeperson plötzlich ausfällt (z. B. durch Krankheit, Unfall oder eigene Reha)
- Pflegebedürftigkeit ohne Einstufung: Hier können Betroffene die Pflege auch privat bezahlen oder über Zusatzversicherungen abdecken.
Gut zu wissen: Voraussetzungen der Kurzzeitpflege
Für die reguläre Kostenübernahme der Kurzzeitpflege ist ein anerkannter Pflegegrad ab Stufe 2 erforderlich.
Bei Pflegegrad 1 gibt es keine gesonderte Pauschale für die Kurzzeitpflege. Sie können jedoch den Entlastungsbetrag (131 € monatlich) ansparen und dafür einsetzen. Ohne Pflegegrad springt die Pflegeversicherung grundsätzlich nicht ein.
Sonderfall: Nach einem Krankenhausaufenthalt kann auch ohne Pflegegrad eine zeitlich befristete Übergangspflege über die Krankenkasse finanziert werden.
Kosten & Leistungen: Was zahlt die Kasse und was zahlen Sie?
Viele Angehörige sind überrascht, wenn sie nach der Kurzzeitpflege eine Rechnung erhalten, obwohl doch ein hohes Budget zur Verfügung steht. Damit Sie Planungssicherheit haben, ist es wichtig, die Kostenstruktur zu verstehen. Denn der Gesetzgeber trennt hier strikt:
Die Pflegekasse übernimmt mit dem Jahresbudget alle pflegebedingten Aufwendungen (also die medizinische Versorgung und Betreuung). Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (oft „Hotelkosten“ genannt) sowie die Instandhaltung der Einrichtung (Investitionskosten) müssen Sie hingegen privat tragen.
Doch keine Sorge: Auch für diesen Eigenanteil gibt es finanzielle Hilfen, die wir Ihnen hier aufschlüsseln.
Das zahlt die Kasse
- Pflege & Betreuung:
(Waschen, Anziehen, Mobilisation) - Medizinische Behandlung:
(Medikamentengabe, Verbandswechsel) - Soziale Betreuung:
(Alltagsgestaltung im Heim)
Ihr Eigenanteil
- Unterkunft ("Hotel"):
(Zimmermiete, Reinigung, Strom) - Verpflegung:
(Alle Mahlzeiten & Getränke) - Investitionskosten:
(Instandhaltung des Gebäudes)
Sie müssen den Eigenanteil nicht zwingend aus der privaten Rente zahlen! Nutzen Sie Ihren monatlichen Entlastungsbetrag (131 €). Wenn Sie diesen Betrag angespart haben, können Sie damit oft die kompletten "Hotelkosten" für 2-3 Wochen Kurzzeitpflege finanzieren. Reichen Sie die Rechnung einfach bei der Pflegekasse ein.
Die Kurzzeitpflege bietet einen verlässlichen Rahmen für die pflegerische Versorgung auf Zeit. Nutzen Sie das gemeinsame Budget von 3.539 €, dass Ihnen für für Kurzzeit- und Verhinderungspflege zur Verfügung steht.
Zusätzlich sorgt der Entlastungsbetrag von 131 € monatlich dafür, dass Alltagshilfen leichter organisiert werden können. Trotz dieser Zuschüsse bleiben Eigenanteile für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten zu berücksichtigen.
Wer die verschiedenen Leistungen geschickt kombiniert und transparent klärt, kann Kurzzeitpflege finanziell planen und gezielt nutzen.
Dauer und Umfang der Kurzzeitpflege
Die Kurzzeitpflege ist von Anfang an als zeitlich begrenzte Unterstützung gedacht. Sie soll in Übergangsphasen helfen, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt oder wenn Angehörige eine Auszeit benötigen.
Entscheidend ist deshalb die Frage: Wie lange kann die Kurzzeitpflege genutzt werden und in welchem Umfang steht sie zur Verfügung?
Die Grenzen im Überblick: Zeit & Budget
Bis zu 56 Tage jährlich. Nutzbar am Stück oder flexibel aufgeteilt.
Für Pflegekosten. Ist das Budget leer, endet die Zahlung oft vor Ablauf der 8 Wochen.
Die Pflegekasse zahlt nur die Pflege. Kosten für Unterkunft, Verpflegung & Investitionskosten müssen Sie privat zuzahlen (Tagessatz variiert je nach Heim).
Tipp: Auch tageweise Nutzung (z.B. Wochenende) ist problemlos möglich.
Die Kurzzeitpflege muss nicht zwangsläufig mehrere Wochen dauern. Auch eine kürzere Unterbringung von nur wenigen Tagen oder eine Aufteilung auf mehrere Abschnitte ist möglich.
Manche Einrichtungen bieten sogar an, Pflegeplätze tageweise oder für wenige Nächte zu vergeben, wenn kurzfristiger Bedarf besteht. Für Angehörige schafft das zusätzliche Flexibilität, wenn sie für ein Wochenende verreisen oder für einige Tage im Krankenhaus sind.
Grundsätzlich stehen bis zu acht Wochen im Jahr zur Verfügung, wobei die tatsächliche Dauer vom Budget abhängt.
Durch das neue Entlastungsbudget von 3.539 Euro pro Jahr können Familien den finanziellen Rahmen deutlich flexibler ausschöpfen. Wer die Leistungen geschickt kombiniert und die Nutzung rechtzeitig plant, kann die Kurzzeitpflege individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Pflegegrad-Rechner 2026: Pflegegeld & Kosten
Berechnen Sie Ihren Anspruch für zu Hause (auch mit Pflegedienst) oder Ihren Eigenanteil im Heim
Pflegehilfsmittel (42 €) & Hausnotruf (25,50 €)
Werte Stand 2026. Angaben ohne Gewähr.
Antrag und Ablauf der Kurzzeitpflege
Damit die Pflegekasse die Kosten für die Kurzzeitpflege übernimmt, muss ein Antrag gestellt werden.
Der Prozess ist zwar unkompliziert, erfordert aber einige Vorbereitungen. Doch wer die notwendigen Schritte kennt und rechtzeitig plant, kann unnötige Verzögerungen vermeiden.
Schritt für Schritt zur Kurzzeitpflege
Haken Sie erledigte Punkte ab. Der Balken zeigt Ihren Fortschritt:
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
Antrag bei der Pflegekasse
Damit die Kostenübernahme reibungslos klappt, muss der Antrag vor Beginn der Maßnahme bei der Pflegekasse eingehen. Klassischerweise fordern Sie die Unterlagen telefonisch an, schneller geht es jedoch auf digitalem Weg.
Ein vollständiges Formular beschleunigt die Prüfung durch den Sachbearbeiter erheblich. Ob Online-Portal oder PDF-Download: Wir haben für Sie die direkten Zugänge zu den Pflege-Services der großen Kassen zusammengestellt.
Wählen Sie einfach Ihre Kasse aus und starten Sie den Antrag:
Antrag auf Kurzzeitpflege: Wählen Sie Ihre Kasse
Klicken Sie auf Ihre Versicherung, um direkt zum Online-Formular oder Download-Bereich für die Kurzzeitpflege zu gelangen:
*Links führen zu den allgemeinen Serviceseiten der Anbieter.
Benötigte Unterlagen
Damit der Antrag bearbeitet werden kann, sollten einige Dokumente bereitliegen. Dazu zählen:
- der aktuelle Pflegegrad-Bescheid,
- die ärztliche Bescheinigung (falls ein Krankenhausaufenthalt der Grund ist),
- eine Bestätigung der Pflegeeinrichtung über den geplanten Aufenthalt.
Je vollständiger die Unterlagen sind, desto schneller kann die Pflegekasse den Antrag prüfen und genehmigen.
Auswahl der Einrichtung
Die Wahl der passenden Pflegeeinrichtung ist ein zentraler Schritt. Nicht jedes Pflegeheim bietet Kurzzeitpflegeplätze an, und diese sind oft schnell vergeben.
Es empfiehlt sich daher, frühzeitig Kontakt zu mehreren Einrichtungen aufzunehmen und nach freien Kapazitäten zu fragen.
Wichtige Kriterien sind:
- die räumliche Nähe zum Wohnort,
- die Qualität und Ausstattung der Einrichtung,
- das Vorhandensein von qualifiziertem Pflegepersonal,
- mögliche Zusatzangebote wie Freizeitaktivitäten oder Therapieangebote.
Viele Angehörige entscheiden sich für eine Einrichtung, die auch für eine mögliche Dauerpflege infrage kommt. So können Pflegebedürftige sich frühzeitig an die Umgebung gewöhnen.
Ablauf der Kurzzeitpflege in der Praxis
Ist die Kurzzeitpflege genehmigt und ein Platz reserviert, übernimmt die Einrichtung die Betreuung für den vereinbarten Zeitraum.
In der Regel beginnt der Aufenthalt mit einem Aufnahmegespräch, bei dem wichtige Informationen ausgetauscht werden:
- Gesundheitszustand,
- aktuelle Medikation und Behandlungspläne,
- persönliche Gewohnheiten und Vorlieben,
- Kontaktpersonen für Rückfragen.
Im Anschluss übernimmt das Pflegepersonal die Versorgung. Angehörige können in dieser Zeit entlastet sein und wissen, dass ihr Familienmitglied gut versorgt ist.
Viele Einrichtungen bieten Besuchsmöglichkeiten an, sodass auch während der Kurzzeitpflege ein enger Kontakt bestehen bleibt. Für Angehörige bedeutet das Entlastung und Sicherheit, für Pflegebedürftige eine professionelle Betreuung auf Zeit.
Sonderfall: Übergangspflege nach Krankenhaus ( ohne Pflegegrad)
Ein Krankenhausaufenthalt ist für viele ältere Menschen ein großer Einschnitt, der zudem auch oft abrupt wieder endet.
Während Ärzte die Entlassung für medizinisch vertretbar halten, fühlen sich Betroffene und Angehörige noch nicht in der Lage, sofort wieder in die eigene Wohnung zurückzukehren. Genau hier setzt die Übergangspflege an, auch als Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt bekannt.
Übergangspflege nach Krankenhausaufenthalt auf einen Blick
Bei Entlassung aus dem Krankenhaus noch nicht zu Hause versorgbar? Die Übergangspflege überbrückt die kritische Zeit, bis die häusliche Pflege gesichert oder ein Reha-Platz gefunden ist – auch komplett ohne Pflegegrad.
Was ist Übergangspflege?
Die Übergangspflege soll die Zeit zwischen Klinik und häuslicher Versorgung überbrücken. Sie kommt dann in Betracht, wenn zwar kein akuter Krankenhausbedarf mehr besteht, aber die Rückkehr in die Wohnung noch nicht möglich ist.
Gründe können körperliche Schwäche, fehlende Mobilität oder eine noch nicht organisierte häusliche Pflege sein.
Unterschiede zur regulären Kurzzeitpflege
Anders als die klassische Kurzzeitpflege ist die Übergangspflege eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie greift daher auch dann, wenn noch kein Pflegegrad vorliegt. Die Finanzierung erfolgt direkt über die Krankenkasse, wobei, ähnlich wie im Krankenhaus, geringe Eigenanteile anfallen können.
Antrag und Bewilligung
Damit Übergangspflege genutzt werden kann, muss der behandelnde Arzt oder das Krankenhaus bescheinigen, dass der Patient nach Entlassung noch nicht zu Hause versorgt werden kann.
Diese ärztliche Bescheinigung dient als Grundlage für die Krankenkasse, die den Antrag prüft und in der Regel kurzfristig bewilligt.
Besonders praktisch: Da die Situation oft überraschend entsteht, helfen Sozialdienste im Krankenhaus oder Pflegeberatungsstellen direkt bei der Antragstellung und der Organisation eines geeigneten Platzes.
Übergang zur regulären Kurzzeitpflege
Nach Ablauf der Übergangspflege kann es sinnvoll sein, direkt in die Kurzzeitpflege der Pflegekasse zu wechseln. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn dauerhaft Unterstützung benötigen wird.
Voraussetzung dafür ist dann allerdings ein anerkannter Pflegegrad. Angehörige sollten deshalb frühzeitig prüfen, ob ein Pflegegrad beantragt werden sollte, um den Übergang möglichst reibungslos zu gestalten.
Kurzzeitpflege für Angehörige: Entlastung im Alltag
Die Pflege eines Angehörigen ist eine Aufgabe, die viel Kraft, Zeit und emotionale Energie erfordert. Viele pflegende Familienmitglieder berichten, dass sie an ihre Grenzen kommen. Meist nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil Pflege mit zahlreichen Verpflichtungen im Alltag verbunden ist.
Hier kann die Kurzzeitpflege eine wertvolle Unterstützung sein: Sie bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, sich zu erholen, eigene Termine wahrzunehmen oder einfach neue Kraft zu schöpfen.
Entlastung im Alltag: Kurzzeitpflege ohne schlechtes Gewissen nutzen
Die Kurzzeitpflege verschafft pflegenden Angehörigen planbare Pausen für die eigene Gesundheit, wichtige Termine oder einfach zur Erholung. Die Versorgung bleibt in professionellen Händen, während Sie Kraft tanken können.
- Zeitraum wählen und 2–3 Einrichtungen anfragen (Reservierung klären).
- Kostenübersicht anfordern: Zuschüsse vs. Eigenanteile prüfen.
- Kontaktperson festlegen und kurze Rückmeldeschleifen vereinbaren.
„Eine Auszeit ist kein Egoismus. Sie ermöglicht die Pflege zuhause überhaupt erst langfristig.“
Entlastung und neue Freiräume
Pflegende Angehörige leisten häufig über Monate oder Jahre hinweg einen enormen Einsatz. Die Kurzzeitpflege schafft in solchen Situationen Raum für Erholung, ohne dass dabei die Versorgung der pflegebedürftigen Person vernachlässigt wird.
Ein Beispiel: Wer sich selbst einer medizinischen Behandlung unterziehen muss oder ein paar Tage Urlaub plant, weiß den Angehörigen in professionellen Händen und kann mit ruhigem Gewissen loslassen.
Mehr Informationen zur Vereinbarkeit von Pflege und Privatleben finden Sie auch in unserem Beitrag zu Entlastung für pflegende Angehörige.
Kurzzeitpflege als präventive Entlastung
Kurzzeitpflege ist nicht nur eine Notlösung nach einem Krankenhausaufenthalt. Sie kann auch als präventive Entlastung genutzt werden:
- um eine dauerhafte Überlastung der Pflegeperson zu vermeiden,
- um Zeit für eigene Arzttermine oder Erledigungen zu schaffen,
- oder um einmal bewusst eine Pause einzulegen, bevor die Situation zu belastend wird.
Wer regelmäßig Entlastungsangebote nutzt, kann langfristig eine stabile Pflegesituation sichern, für sich selbst und die betreute Person.
Ergänzende Leistungen sinnvoll kombinieren
Neben der Kurzzeitpflege stehen Angehörigen weitere Hilfen zur Verfügung. Besonders häufig wird sie mit der Verhinderungspflege kombiniert, die greift, wenn die Hauptpflegeperson kurzfristig ausfällt.
Auch der monatliche Entlastungsbetrag bei Pflegegrad kann eine wichtige Unterstützung sein, etwa für Haushaltshilfen oder Betreuungsangebote.
Fazit: Kurzzeitpflege als wichtige Entlastung
Die Kurzzeitpflege ist ein zentrales Angebot im deutschen Pflegesystem: Sie schafft Sicherheit für Pflegebedürftige und dringend notwendige Entlastung für Angehörige.
Ob nach einem Krankenhausaufenthalt, als Überbrückung in einer Übergangsphase oder zur Erholung der Pflegeperson, bietet die Kurzzeitpflege flexible Lösungen.
Dank des neuen Entlastungsbudgets von 3.539 Euro pro Jahr und ergänzender Leistungen wie Verhinderungs- oder Übergangspflege bestehen vielfältige Möglichkeiten, die Versorgung individuell zu gestalten.
Wer sich frühzeitig informiert, Unterlagen bereithält und die Planung aktiv angeht, kann die Kurzzeitpflege optimal nutzen, für mehr Balance im Alltag und eine verlässliche Pflege auf Zeit.
🔍 Nutzen Sie alle Ihre Ansprüche?
Viele Leistungen und Nachteilsausgleiche greifen ineinander. Informieren Sie sich hier umfassend über die drei wichtigsten Säulen der Versorgung:
GdB & Ausweis
Ab wann gilt man als schwerbehindert? Alle Tabellen, Steuervorteile und Antragstipps im Überblick.
Zur GdB-Übersicht →Merkzeichen
G, aG, H oder Gl? Welche Zusatz-Buchstaben Ihnen zustehen und welche Vorteile (z.B. Parken) sie bringen.
Zu den Merkzeichen →Pflegegrad
Pflegegeld, Sachleistungen & Hilfe im Alltag. Aktuelle Tabellen und Ratgeber zu Pflegegrad 1 bis 5.
Zur Pflege-Übersicht →Häufige Fragen zur Kurzzeitpflege (FAQ)
Viele Angehörige und Pflegebedürftige stoßen bei der Organisation der Kurzzeitpflege immer wieder auf die gleichen Fragen. Hier findest du die wichtigsten Antworten im Überblick:
Wie lange kann Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden?
Die Kurzzeitpflege ist auf maximal 8 Wochen pro Kalenderjahr begrenzt. Entscheidend ist jedoch das verfügbare Budget: Seit Juli 2025 gilt ein gemeinsames Entlastungsbudget von bis zu 3.539 € für Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammen.
Was kostet die Kurzzeitpflege?
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für die pflegerische Versorgung im Rahmen des Budgets. Eigenanteile für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen privat gezahlt werden. Diese unterscheiden sich je nach Einrichtung.
Kann Kurzzeitpflege auch ohne Pflegegrad genutzt werden?
Ja nach einem Krankenhausaufenthalt gibt es die sogenannte Übergangspflege. Sie wird von der Krankenkasse übernommen und ist auch ohne Pflegegrad möglich, in der Regel für bis zu 10 Tage.
Wie unterscheidet sich Kurzzeitpflege von Verhinderungspflege?
Die Kurzzeitpflege findet stationär in einer Einrichtung statt, während die Verhinderungspflege meist zu Hause durch Ersatzpflegepersonen erfolgt. Seit Juli 2025 gibt es für beide Leistungen ein gemeinsames Jahresbudget. → Mehr dazu im Kapitel Unterschiede: Kurzzeitpflege vs. Verhinderungspflege.
Wie beantrage ich Kurzzeitpflege?
Der Antrag läuft über die Pflegekasse. Er kann formlos gestartet werden (Telefon, Brief, E-Mail). Wichtig sind: Pflegegrad-Bescheid, ärztliche Unterlagen (falls nötig) und die Bestätigung der Einrichtung.
Was passiert, wenn das Budget ausgeschöpft ist?
Sobald das Budget aufgebraucht ist, müssen weitere Kosten selbst getragen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Sozialamt einspringen. Hier lohnt sich ein Gespräch mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI.
Offizielle Quellen & Weiterführende Links
Rechtlicher Hinweis: Dieser Ratgeber wurde mit größter Sorgfalt erstellt (Stand: 2026). Gesetze können sich ändern. Für eine verbindliche Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegekasse, einen Pflegestützpunkt oder einen Fachanwalt für Sozialrecht.